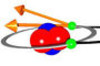Hohe Energiedichte durch ultraschnelle Laser
Einem Team deutscher Physiker ist ein wichtiges Grundlagenexperiment zum Verhalten von Atomen in extrem starkem Laserlicht gelungen.
Sie können extrem kurze Laserpulse vom Hunderttausendstel einer milliardstel Sekunde Dauer erzeugen und damit die Energie eines Pulses zeitlich um den Faktor eine Million konzentrieren.
Überraschendes Ergebnis
Atome verlieren unter Energiezufuhr einzelne Elektronen. Auf
einer Konferenz über ultraschnelle Laser hörte der Marburger
Physiker Dr. Harald Giessen dann jedoch, dass Atome unter extrem
starkem Laserlicht viel häufiger als erwartet ihre Elektronen gleich
paarweise verlieren. Harald Giessen überschlug die Zahlen auf einem
Fetzen Papier und kam zu einem Ergebnis, das ihn selbst verblüffte:
Mit seinem Marburger Laser müsste es möglich sein, die für das
atom-physikalische Grundlagenexperiment notwendige Energiedichte zu
erreichen.
 Presseausendung der Universität Marburg
Presseausendung der Universität MarburgFaktor 100 Millionen
Die Physiker können damit Laserlicht auf eine so kleine Fläche fokussieren, dass sie damit gleich mehrere Löcher nebeneinander auf eine Haaresbreite brennen können.
In der Summe können also Energiedichten erzeugt werden, die 100 Millionen Mal größer sind als bei der Konkurrenz.
Vergebliche Versuche in den USA
Laut eines theoretischen Physikers aus Kanada verlieren Atome
ihre Elektronen unter extrem starkem Laserlicht viel häufiger als
erwartet gleich paarweise. Um den Mechanismus zu verstehen, müsste
man Energiedichten von etwa einer Billiarde Watt pro
Quadratzentimeter erreichen, spekulierte der Theoretiker. Am
Lawrence-Livermore-Laboratorium, wo im Rahmen der US-amerikanischen
Rüstungsforschung die stärksten Laser der Welt unterhalten werden,
hatte man vergeblich versucht, dieses Experiment durchzuführen.
 Lawrence Livermore National Laboratory
Lawrence Livermore National LaboratoryLösung durch Zusammenarbeit
In Zusammenarbeit mit Physikern aus Frankfurt gelang den Marburger Forschern auch die Lösung des zweiten Problems: Elektronen und verbliebene Restatome müssen nachgewiesen werden.
Die Frankfurter Physiker betreiben als Einzige in Deutschland einen Detektor, der es erlaubt, gleichzeitig die Elektronenpaare sowie die positiv geladenen Atomreste aufzuspüren.
Aufsehen unter Physikern
Die Ergebnisse haben für Aufsehen in der Physiker-Gemeinde
gesorgt: Nicht nur klappte ein für aussichtslos gehaltenes
Experiment, es gelang auch noch einer Arbeitsgruppe, die gar nicht
zu den etablierten Spielern auf dem Gebiet gehört. Der Lohn ist eine
Veröffentlichung in "Nature" [8. Juni], die als die führende
Zeitschrift für Naturwissenschaften gilt.
 Nature
NatureZweite Bestätigung
Die Physiker Harald Giessen und Reinhard Dörner haben inzwischen auch noch einen zweiten Beleg für diese Modellvorstellung erbringen können. Es ist ihnen gelungen, die Intensität des Laserlichts noch weiter zu steigern.
Prinzip des "Elektronenverlustes"
Jetzt ist klar, warum viel häufiger als erwartet Elektronen von
starkem Laserlicht gleich paarweise herausgerissen werden: Am besten
stellt man sich die äußeren Elektronen des Argons als Stahlkugeln
vor, die auf einem periodisch hin- und herschwankenden Tablett
herumrollen. Das elektrische Feld des Laserlichts sorgt für eine
zusätzliche Neigung des Tabletts. Bevor aber eine Stahlkugel
endgültig herunterfallen kann, neigt sich das Tablett schon wieder
zur anderen Seite, und die Kugel rollt zurück. Dabei kann sie auf
eine zweite Kugel stoßen, und beide fliegen gemeinsam vom Tablett
herunter.
 Physik an der Universität Marburg
Physik an der Universität Marburg