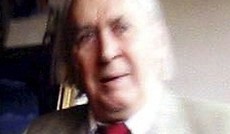
J. G. Ballard: Ein Leben im Lager
Der britische Schriftsteller James Graham Ballard war einer der wichtigsten Chronisten der Konsum- und Kontrollgesellschaft. Er verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren.
Als im vergangenen Jahr "Miracles of Life" erschien, die Autobiografie des britischen Schriftstellers James Graham Ballard, war klar, dass dies seine letzte große Veröffentlichung sein würde. Ballard beschließt das Buch, indem er erzählt, wie sein Arzt Mitte 2006 bei ihm Krebs diagnostizierte. Nun hat auch sein Leben ein Ende gefunden, er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Damit schweigt ein Mann, der wie kein zweiter die Malaisen der mittelständischen Konsum- und Kontrollgesellschaft beschrieben hat.
Ballards prägende Erfahrung ist die des Lebens im Lager, einer umgrenzten kontrollierten Umgebung, deren soziale Normen sich aus der Enge ergeben. 1930 kommt er als Sohn einer britischen Textilunternehmerfamilie in Shanghai auf die Welt und lebt zunächst im internationalen Viertel, einer abgeschotteten Luxuswelt für Europäer.
1937 greifen die Japaner China an und nehmen Shanghai in Besitz. Ballard erzählt, wie die Invasoren 1943 einen Teil der Bevölkerung des internationalen Viertels in ein Internierungszentrum verbrachten. Abgeschottet gelebt hatten sie schon vorher, aber nun waren die Ballards und ihre Nachbarn Gefangene. Ballard beschrieb das Leben dort in seinem wohl bekanntesten Buch "Empire of the Sun" (1984), das von Steven Spielberg 1987 verfilmt wurde.
Die beste Ressource zu Ballard im Web ist die von dem australischen Sozialwissenschaftler Simon Sellars im Rahmen von dessen Dissertation aufgebaute Site Ballardian.com. Dort finden sich eine ausführliche Bibliografie sowie zahlreiche Artikel über Ballard und seine Einflüsse auf die zeitgenössische Kultur.
Aus dem Krieg in die Ödnis
1946 zieht die Familie zurück nach Großbritannien. Für den jungen Ballard, der in einem ultramodernen Haushalt mit zehn chinesischen Dienern aufgewachsen war, sieht sein zerstörtes Heimatland, das er nur aus Zeitschriften und Büchern kannte, nicht wie eine Nation der Sieger aus. Aus Nachkriegsgrau und Internatsödnis flüchtet Ballard ins Kino. Ein Studium der Medizin und Psychologie in Cambridge bricht er schnell ab, die Bilder der Leichen auf den Seziertischen verschmelzen in seiner Wahrnehmung mit den Erinnerungen an die Toten aus den Kämpfen um Shanghai.
1953 schreibt sich Ballard bei der Royal Air Force ein und wird zum Flugtraining nach Kanada abkommandiert. Die militärische Langeweile bekämpft er, indem er Science-Fiction-Magazine verschlingt. Schnell stellt er fest, dass ihn die damals üblichen "Space Operas" nicht interessieren. "Als Vorläufer von 'Star Trek' beschreiben sie ein US-amerikanisches Imperium, das sich anschickt, das ganze Universum zu kolonisieren und es in eine fröhlich-optimistische Hölle zu verwandeln, eine Vorstadt der 1950er Jahre, voll guter Absichten und bevölkert von lächelnden Hausfrauen in Raumanzügen. Eine Vision, die sich als merkwürdig korrekt herausstellen könnte", schreibt Ballard.
"This is Tomorrow"
1956, zurück aus Kanada, veröffentlicht Ballard seine erste eigene SF-Story. Außerdem besucht er die Ausstellung "This is Tomorrow" in der Whitechapel-Kunstgalerie. Diese Ausstellung gilt heute als einer der Meilensteine in der Entwicklung der britischen Popkultur. Sie markiert den Übergang von der ständigen Mangelverwaltung der Nachkriegsjahre zur Konsumgesellschaft.
In Richard Hamiltons Collage "Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?" fährt Robby, der Roboter aus dem SF-Klassiker "Forbidden Planet", zwischen Staubsaugern und Polstermöbeln herum. Die Grenzen zwischen Hoch- und Massenkultur wurden porös. Es ist nun keine Schande mehr, Science-Fiction zu schreiben, es ist eine Pflicht.
Ballard beschließt, sich nicht um den öden Techno-Weltraum der "Space Operas" zu kümmern, sondern um den "Inner Space", um die Auswirkungen der Konsumgesellschaft auf die Gesellschaft. Er heiratet, seine Frau Mary bringt drei Kinder zur Welt, die junge Familie zieht in den Londoner Vorort Shepperton, Ballard nimmt einen Job bei einem Fachblatt für die chemische Industrie an. Auch dort geht es um den Stoff, aus dem die Zukunft gemacht ist: Plastik. 1961 publiziert er in den USA seinen ersten Roman, "The Wind from Nowhere", den er später aber als zu kommerziell verwerfen sollte.
Der erste Roman, mit dem Ballard zufrieden ist, erscheint kurz darauf in Großbritannien. "The Drowned World", eine Geschichte über ein London, das halb unter Wasser steht - die Sonne hat die Polkappen angetaut, ein unheimlich aktuelles Thema. Der Roman wird ein Erfolg, Ballard gibt seinen Redakteursjob bei "Chemistry & Industry" auf und beschließt, seine Familie als professioneller Schriftsteller am Leben zu erhalten. Er wird einer der wichtigsten Protagonisten der "New Wave" in der Science-Fiction, deren Autoren die Konflikte vom Weltraum ins Innere des modernen Menschen verlegen.
Unter der Plastikhaut
Zu der Plastikwelt, über die er bei "Chemistry & Industry" berichtet hat, entwickelt Ballard ein ganz spezielles Verhältnis. Die bunte Verpackung zieht ihn an, aber er kann nicht anders, als sie aufzuschneiden, mit dem Skalpell, wie es einem ehemaligen Studenten der Medizin zukommt. In den optimistischen Zukunftsentwürfen seiner Zeit findet er stets Aspekte des Lagers wieder.
Während Urbanisten noch die Vorteile der Hochhaussiedlung anpreisen, schreibt Ballard "High Rise" (1975), einen klar konstruierten Text, der davon handelt, wie die Mittelklasse-Bewohner eines neuen Designer-Hochhausturms in tribalistisch-primitive Kämpfe herabsinken und dabei das Haus systematisch zerstören.
Das Automobil lässt Ballard zweimal zur Falle werden: Einmal in "Crash" (1973), wo das Blech zum eng sitzenden Fetisch wird, der die Protagonisten des Romans zerquetschen wird, dann wieder in "Concrete Island" (1974), in dem er einen Architekten mit seinem Jaguar von der Autobahn in einen toten Winkel der Stadt fallen lässt, aus dem es zunächst keinen Ausweg gibt.
Auch in den neueren Arbeiten Ballards ist das Lager präsent, das sich immer wieder als Falle für dessen Mittelschicht-Bewohner erweist, die sich in die vermeintliche Sicherheit umgrenzter Gebiete zurückziehen wollten, um dort endlich Ruhe zu finden. Ab "Cocaine Nights" (1996), einem Thriller über Gewalt in einer südspanischen Feriensiedlung für Pensionisten, wird Ballard zum Chronisten einer Gesellschaft, die die Theorien Michel Foucaults hinter sich gelassen hat. Alle sperren sich freiwillig ein, werden überwacht und manchmal auch bestraft, aber alle Aktionen der Kontrolle laufen ins Leere, niemand lässt sich disziplinieren. Jeremy Bentham, der Erfinder des Überwachungsgefängnisses Panoptikon, hat nach außen hin gesiegt, aber nach innen versagt.
Versagen der Kontrollgesellschaft
In "Super-Cannes" (2000), Ballards Parodie auf das Leben im abgeriegelten südfranzösischen Technopark Sophia Antipolis, leben alle in kontrollierter Gartenlandschaft, werden ständig überwacht, trotzdem ist jeder ein Verbrecher. In "Millennium People" (2003) und "Kingdom Come" (2006) konzentriert Ballard seine Erfahrungen aus 40 Jahren Existenz in der Vorstadt. Die von Politik und Medien in die letzte Ecke geängstigten Mittelklasse-Briten werden bissig. Sobald sie ihre abgezirkelten Lebensräume verlassen, laufen sie Amok.
Ballards Spätwerk ist ein einziger Zweifel am Rationalismus, der hinter der Kontrollgesellschaft steht. In "The Miracles of Life" schreibt er über seine ersten Jahre an britischen Schulen: "Der Glaube an die Vernunft, der das Denken der Nachkriegszeit beherrschte, kam mir hoffnungslos idealistisch vor, ähnlich wie der Glaube, dass die Deutschen von Hitler und den Nazis getäuscht worden seien. Ich war mir sicher, dass die zahllosen Grausamkeiten in Osteuropa deshalb stattgefunden hatten, weil die daran beteiligten Deutschen den Akt des Massenmords genossen haben, genauso wie die Japaner es genossen haben, die Chinesen zu foltern. Vernunft und Rationalität können das menschliche Verhalten nicht beschreiben." Der Zweifel an der menschlichen Vernunft ist Ballards Programm.
Das Lager als Gespensterstadt
Eine Rettung nach Hollywood-Schema gibt es bei Ballard nicht. So wie die Japaner 1945 das Internierungscamp in Shanghai quasi über Nacht aufgaben, so brechen die mentalen Gefängnisse in seinen Geschichten von selbst wieder zusammen, aber meist in einer Art und Geschwindigkeit, die ihr Verschwinden noch unheimlicher anmuten lassen als ihr Entstehen. Die konstruktive Ordnung ist bei Ballard ein glücklicher Ausnahmefall, der geniale Masterplan führt bei ihm stets zum Aufbau neuer Lager, die Liebe zum Detail ist der Keim des Totalitären.
Im Privatleben war Ballard sicher kein Misanthrop. 1963 starb seine junge Frau Mary an einer Lungenentzündung als Auswirkung einer missglückten Blinddarmoperation, von nun an musste er seine drei kleinen Kinder alleine erziehen. Dass ihm das gelungen ist - Ballard pflegte zu beiden Töchtern und seinem Sohn offenbar beste Beziehungen -, sieht er als Beweis dafür, dass sein Leben erfolgreich war. "Enkel zu haben nimmt einem die Angst vor dem Tod", schreibt er in seiner Autobiografie, "ich habe meine biologische Pflicht erfüllt und die wichtigste Aufgabe auf der genetischen Job-Liste erledigt." Das Kapitel über seine Krankheit ist kurz. Es trägt den Titel "Auf dem Heimweg".
(futurezone/Günter Hack)
